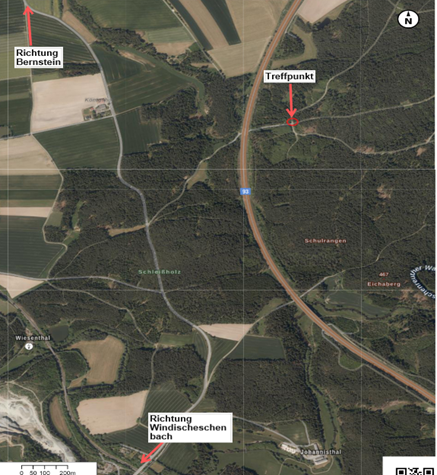Sehr geehrte Damen und Herren,
bitte beachten Sie die nachfolgenden Informationen der SVLFG zur Förderung von Präventionsprodukten. Die Präventionszuschüsse können Unternehmen beantragen, die bei der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft (LBG) versichert sind.
Die Zuschüsse werden im „Windhundverfahren“ vergeben. Daher zählt Schnelligkeit! Merken Sie sich den Termin vor: Antragsbeginn 15. Januar 2026 um 10 Uhr
Sichern Sie Ihre Förderprämie! Für das Jahr 2026 wird die Fördersumme deutlich aufgestockt: Statt bislang einer Million Euro stehen nun insgesamt vier Millionen Euro zur Verfügung. Gleichzeitig wurde der Prämienkatalog spürbar erweitert.
Die Förderung ist auf 25 % des zuletzt in Rechnung gestellten LBG-Beitrags begrenzt. Darüber hinaus werden bis zu 25 % der Anschaffungskosten – jeweils bis zum festgelegten Maximalbetrag – erstattet. Antragsberechtigt sind alle Unternehmen, auch wenn sie bereits im Jahr 2025 einen Zuschuss erhalten haben. Pro Unternehmen kann für das Jahr 2026 ein Antrag gestellt werden.
Ziel der Fördermaßnahmen ist es, die Arbeitssicherheit in den Forstbetrieben nachhaltig zu verbessern und präventive Investitionen gezielt zu unterstützen.
Diese Produkte bietet die SVLFG für die Branche Forst/Jagd an:
- Funkgesteuerte Fällkeile
Maximalförderung: 600 Euro Liste förderfähiger Produkte
- Gehörschutzkombination mit Funk
Maximalförderung: 300 Euro
- Jungwuchs- und Jungbestandspflegegeräte
Maximalförderung: 300 Euro
- Kommunikation und Notruf
Maximalförderung: 300 Euro Liste förderfähiger Produkte
- Mobiles Presssystem für Seilverbindungen
Maximalförderung: 625 Euro
- PNA-Geräte, Hardware, 1 Jahr Abo für Notrufzentrale
Maximalförderung: 375 Euro
- Schalldämpfer bei Jagdwaffen (katasterabhängig, nur für Jagd und Forst)
Maximalförderung: 200 Euro
- Spillwinden (katasterabhängig, nur für Jagd und Forst)
Maximalförderung: 375 Euro
WICHTIGER HINWEIS:
Die Antragstellung ist nur noch über das Versichertenportal möglich. Zur Registrierung: Versichertenportal der SVLFG
Weitere Informationen:
Alles SVLFG 4 25 Neues Prämiensystem
Kontakt zum Team Präventionszuschüsse bei der SVLFG:
Telefon: 0561 785-10479
Mit freundlichen Grüßen
Ihr
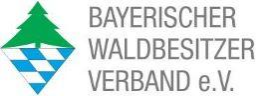
Max-Joseph-Str. 7, Rgb.
80333 München
Tel. 089-539 06 68 – 0
Fax 089-539 06 68 – 29